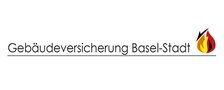Waldbrände in der Schweiz: Ursache, Gefahr und Prävention
Waldbrände sind in der Schweiz zwar nicht so häufig wie in anderen Ländern, aber sie können dennoch enorme Schäden anrichten. Doch wie entstehen Waldbrände, wie werden sie bekämpft und wie können wir sie verhindern? Ricardo Arpagaus, stellvertretender Leiter Feuerwehr bei der Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden teilt mit uns seine Erfahrungen.
Gespräch mit Ricardo Arpagaus
Bereichsinspektor, stv. Leiter Feuerwehr
bei Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden
Wie entstehen Waldbrände?
Gemäss dem Bundesamt für Umwelt BAFU werden in der Schweiz 90 % der Waldbrände durch uns Menschen verursacht, meistens infolge Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit. Beispielsweise durch das Wegwerfen von Zigaretten, unzureichend gelöschte Feuer oder heisse Katalysatoren von Fahrzeugen, die im Wald abgestellt werden. Auch die vorsätzliche Brandstiftung zählt zu den Auslösern. In den Sommermonaten können zudem Blitzschläge Waldbrände verursachen. Besonders in trockenen Perioden kann bereits ein einziger Funke einen Waldbrand auslösen.
Wie löscht die Feuerwehr Waldbrände?
Unsere Feuerwehren nutzen verschiedene Methoden, um Waldbrände zu bekämpfen. In gut zugänglichen Gebieten können sie Wasser mit Tanklöschfahrzeugen zur Brandbekämpfung einsetzen. Hingegen sind in schwer zugänglichem Gelände Helikopter ein sehr effizientes und wirkungsvolles Einsatzmittel. Sie ermöglichen es, Wasser gezielt abzuwerfen und die Ausbreitung der Feuerfront rasch einzudämmen.
«Ich wünsche mir, dass sich mehr Menschen bewusst sind, wie schnell ein kleiner Funke eine Katastrophe auslösen kann.»
Wo liegen die Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten?
Waldbrände stellen für unsere Feuerwehren eine besondere Herausforderung dar, da sie häufig in unzugänglichem Gelände auftreten. Wind macht das Feuer unberechenbar und ein Mangel an Wasser erschwert die Löscharbeiten zusätzlich. Solche Einsätze ziehen sich oft über längere Zeit hin, da versteckte Glutnester immer wieder aufflammen können.
Besonders heimtückisch sind sogenannte Bodenfeuer. Diese Brände glimmen oft unbemerkt unter der Erdoberfläche. Sie können sich über Tage oder sogar Wochen hinweg langsam, aber stetig ausbreiten. Dabei entzünden sie unterirdische Wurzeln oder organisches Material wie Torfböden. Erreichen sie wieder die Oberfläche, können sie neue Brände auslösen.
Bodenfeuer sind äusserst schwer zu bekämpfen, da sie tief im Erdreich brennen. Mit Wasser allein können wir sie nicht wirksam löschen. In solchen Fällen müssen wir den Boden aufgraben, um die Glutnester gezielt zu erreichen und zu löschen.
Wo liegen die Gefahren im Waldbrandeinsatz?
Beim Löschen von Waldbränden sind die Gefahren für das Personal nicht zu unterschätzen. Die Feuerwehrleute sind darauf ausgerichtet, so schnell wie möglich Hilfe zu leisten. Ein ungeplanter oder falsch koordinierter Einsatz kann jedoch zu gefährlichen Situationen führen und die Feuerwehrleute im schlimmsten Fall in grosse Gefahr bringen.
Auch zu beachten ist, dass bei einem Waldbrand die obersten Schichten des Waldbodens verbrennen. Dadurch entsteht über die gesamte Brandfläche hinweg eine instabile, lose Oberfläche. Steine, die zuvor durch diese Bodenschicht fixiert waren, können unkontrolliert abrutschen oder durch einen Wasserabwurf aus dem Helikopter weggeschwemmt werden. Diese Steine können Einsatzkräfte treffen, die sich weiter unten im Gelände befinden.
Wie können Waldbrände vermeiden werden?
Wir alle können dazu beitragen, Waldbrände zu verhindern. Offenes Feuer darf nur an offiziellen Feuerstellen entzündet werden. Dabei ist immer auf einen ausreichenden Abstand zu Bäumen und trockenem Unterholz zu achten. Raucher sollten ihre Zigaretten korrekt entsorgen und sie nicht achtlos wegwerfen. Fahrzeuge dürfen ausserdem nicht auf trockenem Gras abgestellt werden, da die Hitze des Katalysators Brände verursachen kann.
Facts zu Waldbränden in der Schweiz
- Zwischen 2015 und 2022 wurden in der Schweiz jährlich durchschnittlich 114 Waldbrände pro Jahr verzeichnet. Dabei verbrannten etwa 143 Hektar Waldfläche. Das entspricht rund 200 Fussballfelder.
- Die meisten Brände (57 %) finden in der Vegetationsperiode von Mai bis November statt. Doch der grösste Anteil der Brandfläche (88 %) ist von winterlichen Bodenfeuern betroffen.
- Durch Blitzschlag entstehen im Durchschnitt 24 % der Brände in der Vegetationsperiode und 13,7 % im gesamten Jahr.
- Die Brandfläche südlich der Alpen war mit insgesamt 352 Hektaren pro 1000 Quadratkilometer brennbarer Fläche um ein Vielfaches höher als in den übrigen Regionen der Schweiz (Alpen: 8 ha/1000 km2, Jura: 5 ha/1000 km2).
Quelle: Waldbericht 2025 von BAFU/WSL
Wo kann ich mich über die Waldbrandgefahr informieren?
Die beste Anlaufstelle für aktuelle Informationen zur Waldbrandgefahr in der Schweiz ist die Website www.waldbrandgefahr.ch. Darauf sind die aktuellen Gefahrenstufen für die verschiedenen Regionen ersichtlich. Auch geben kantonale Feuerwehren und Forstdienste regelmässig Updates zur Lage.
«Es ist frustrierend, wenn trotz hoher Waldbrandgefahr und klaren Warnungen weiterhin Feuer gemacht wird oder Verbote einfach ignoriert werden.»
Worauf muss ich beim Grillieren im Wald achten?
Wenn kein Feuerverbot gilt, darf ein offenes Feuer nur an offiziellen Feuerstellen entzündet werden. Dabei ist stets ein ausreichender Abstand zur Vegetation einzuhalten und das Feuer muss immer beaufsichtigt werden. Nach dem Grillieren muss unbedingt sichergestellt werden, dass die Glut mit viel Wasser vollständig gelöscht ist.
Viele Hinweise zur sicheren Nutzung von Feuerstellen finden Sie auf der Website der BFB.